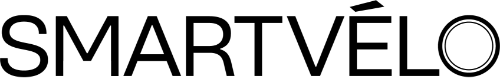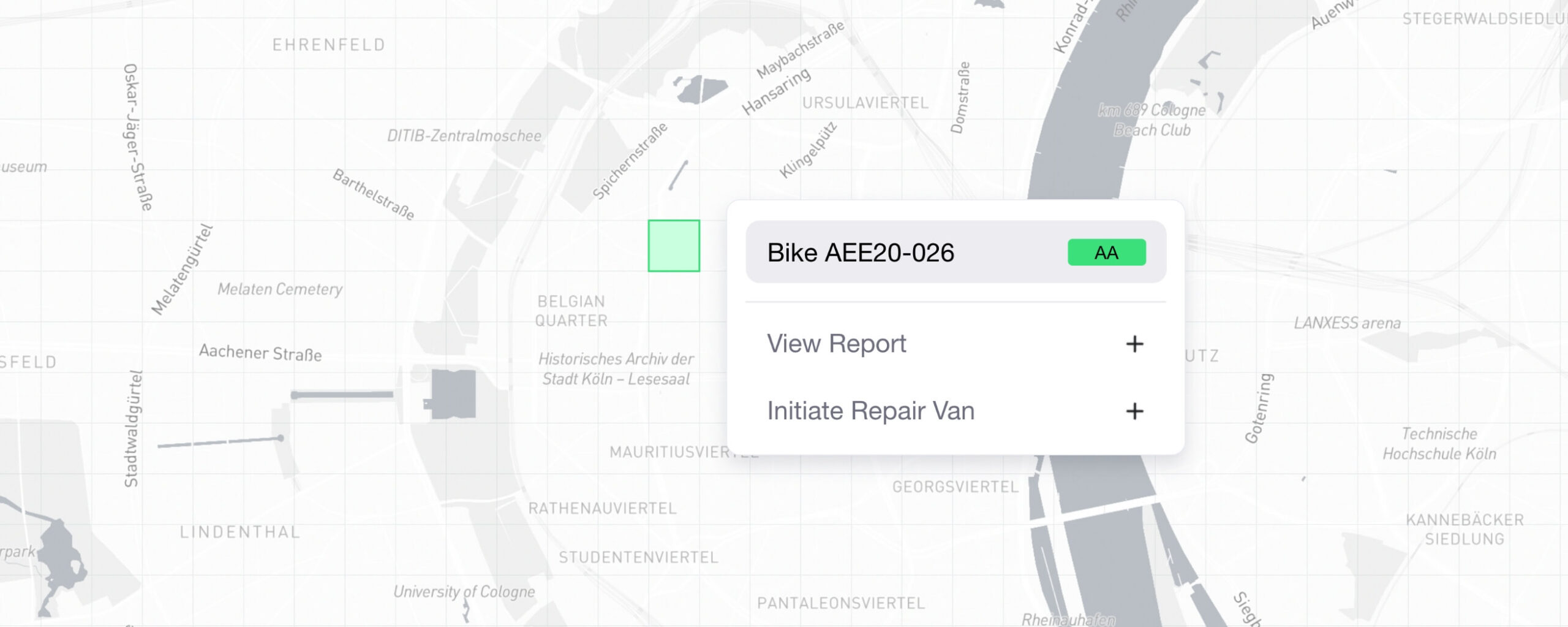Innenstädte stehen vor einem Wandel in der Lieferlogistik: E-Lastenräder ersetzen zunehmend den klassischen Lieferwagen auf der „letzten Meile“. Städte und Kommunen in Deutschland fördern diesen Trend mit vielfältigen Maßnahmen – von finanziellen Förderprogrammen über neue Infrastruktur bis hin zu verkehrsberuhigten Zonen. Dieser Beitrag beleuchtet aktuelle städtische Initiativen in deutschen Großstädten (Berlin, Hamburg, München, Köln) zur Förderung von Lastenrädern, gibt Beispiele für Pilotprojekte (Mikro-Depots, autofreie Zonen) und vergleicht Modelle aus Belgien und den Niederlanden. Zudem zeigen wir, wie Lieferunternehmen und Flottenbetreiber:innen diese Entwicklungen strategisch für sich nutzen können.
Förderprogramme und Konzepte in deutschen Großstädten
Berlin
Die Hauptstadt war früh aktiv bei der urbanen Lastenrad-Logistik. 2018 startete das Pilotprojekt KoMoDo als Mikro-Depot für Paketdienste: Auf einem Gelände der BEHALA im Prenzlauer Berg stellten fünf große Paketdienste Container auf und lieferten Pakete von dort per Cargo-Bike aus – ein bundesweit beachtetes Modell.
Aufbauend auf solchen Erfahrungen plant Berlin nun, die Anzahl dezentraler, anbieterneutraler Mikro-Depots in der Stadt deutlich zu erhöhen, um mehr Sendungen auf Lastenräder zu verlagern. Im aktuellen Koalitionsvertrag sind außerdem neue Kaufprämien vorgesehen, die gezielt gewerbliche und soziale Nutzungen von E-Lastenrädern fördern. Perspektivisch wird sogar eine Zero-Emission-Zone in Betracht gezogen – mittelfristig soll ein Innenstadtbereich eingerichtet werden, der von Fahrzeugen mit fossilem Antrieb freigehalten wird. Diese politischen Weichenstellungen untermauern Berlins Anspruch, klimafreundliche Stadtlogistik voranzutreiben.
Hamburg
Die Hansestadt will laut Klimaplan zur „Modellregion für Letzte-Meile-Logistik“ werden. Konkret bedeutet das einen Ausbau der Lastenrad-Infrastruktur und die Bereitstellung von Flächen für Mikrohubs.
Ein Blick nach Hamburg zeigt bereits erfolgreiche Pilotprojekte: Zwei Jahre lang betrieb die städtische Hochbahn in der Innenstadt (Burchardstraße) ein gemeinsam genutztes Mikro-Depot für Paketdienste. Dienstleister wie Rewe, Hermes, UPS und Deutsche Post lieferten von dort über Lastenfahrräder aus und wickelten über 300.000 Sendungen emissionsfrei ab. Dieses Konzept „Lastenrad statt Lieferwagen“ hat sich bewährt und wird nun von einem privaten Partner als permanenter City-Hub weitergeführt.
Zudem hat Hamburg eine umfangreiche Studie zum Infrastrukturbedarf veröffentlicht, um künftig bis zu 25 % aller Pakete per Lastenrad zustellen zu können. Darin enthalten sind Leitfäden für Lieferzonen, Abstellanlagen und weitere Mikro-Depot-Standorte in verschiedenen Vierteln – ein Fahrplan, wie Hamburgs Quartiere radlogistik-freundlich umgestaltet werden können.
München
Auch die bayerische Landeshauptstadt setzt auf E-Lastenräder, um Verkehr und Emissionen zu reduzieren. München hat von allen deutschen Millionenstädten die höchste Paketdichte, weshalb die Stadtpolitik gegensteuert.
Im Rahmen der Mobilitätsstrategie 2035 entsteht auf dem Viehhof-Gelände ein erstes städtisches „Radlogistik-Hub“: Dort sollen verschiedene Paketdienste zentral ihre Lieferwagen entladen und Sendungen auf Lastenräder umladen, um die umliegenden Wohnviertel emissionsarm zu beliefern. Wenn dieses Pilotprojekt erfolgreich ist, sind weitere dezentrale Hubs in anderen Stadtteilen geplant.
Inspiration liefert ein privates Beispiel: Bereits seit 2017 betreibt UPS in München ein eigenes Mikro-Depot am Glockenbachviertel, von dem aus Pakete mit robusten E-Lastenfahrrädern zugestellt werden. Solche Best Practices zeigen, dass Cargo-Bikes auch in einer Großstadt funktionieren – nun schafft München die Rahmenbedingungen, damit mehr Anbieter:innen auf Cargo-Bikes umsteigen und Dieseltransporter aus Wohngebieten verdrängt werden.
Außerdem bieten kommunale Programme Zuschüsse an: München fördert etwa gewerblich genutzte E-Lastenräder über ein städtisches Förderbudget (neben den Landesmitteln Bayerns) und setzt so zusätzliche Anreize für Unternehmen.
Köln
Die Rheinmetropole fokussiert vor allem finanzielle Anreize, um Lastenräder in die Breite zu bringen. Seit 2019 hat Köln ein eigenes Förderprogramm für Lastenfahrräder aufgelegt, durch das bis Ende 2023 bereits 1.537 Lastenräder mit insgesamt rund 1,945 Millionen Euro bezuschusst wurden.
Zahlreiche kleine Unternehmen, Vereine und sogar Privatinitiativen konnten dadurch auf emissionsfreie Transportmittel umsteigen. Diese Förderung – bis zu 2.500 € pro E-Lastenrad, teils 45 % der Anschaffungskosten – machte Lastenräder für viele erschwinglich. Das Programm war so beliebt, dass die Mittel zeitweise ausgeschöpft waren (2024 pausiert; eine Fortsetzung ist in Planung).
Flankierend richtet Köln immer mehr Fahrradstraßen und verkehrsberuhigte Zonen ein, was den Einsatz von Lastenrädern erleichtert. Zwar hat Köln (noch) kein eigenes Mikro-Depot-Projekt wie Berlin oder Hamburg, aber durch die breite Basis an geförderten Cargobikes entstehen neue Lieferdienste und Konzepte, die den städtischen Lieferverkehr sukzessive entlasten.
Bundesweites Förderprogramm: Zuschüsse des BMWK für gewerbliche E-Lastenräder
Neben den lokalen Initiativen der Städte existiert seit Oktober 2024 auch eine bundesweite Fördermöglichkeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).
Im Rahmen der E-Lastenfahrrad-Richtlinie werden Unternehmen, freiberuflich Tätige und öffentlich-rechtliche Körperschaften (wie Hochschulen) mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen beim Kauf fabrikneuer E-Lastenräder (z. B. SMARTVÉLO) unterstützt.
Die Förderung beträgt 25 % der Anschaffungskosten (inkl. sicherheitsrelevanter Ausstattung, GPS-Tracker etc.), maximal 3.500 € pro Rad. Förderfähig sind ausschließlich Lastenpedelecs für den gewerblichen Gütertransport, die fest verbaute Transportmöglichkeiten bieten und mindestens 170 kg zulässiges Gesamtgewicht aufweisen. Sharingmodelle, Privatnutzung oder Personentransport sind ausgeschlossen.
Mit SMARTVÉLO profitieren Unternehmen von staatlicher Förderung: Beim Direktkauf eines gewerblich genutzten E-Lastenfahrrads werden 25 % der Anschaffungskosten über das Förderprogramm des BAFA erstattet (mehr erfahren). Gerne beraten wir dazu!
Praxisbeispiele: Mikro-Depots, Pilotprojekte und verkehrsberuhigte Zonen
Städte und Logistikunternehmen experimentieren in Modellversuchen, wie sich Lastenräder effizient in die Lieferkette integrieren lassen.
Mikro-Depots: In Berlin zeigte KoMoDo bereits 2018, dass ein gemeinschaftlich genutztes Container-Depot im Innenstadtbezirk funktionieren kann – wenn auch mit getrennten Bereichen je Anbieter:in. In Hamburg wurde dieses Prinzip weiterentwickelt: Im RealLabHH-Projekt teilten sich mehrere Paketdienste ein zentrales City-Depot und reduzierten dadurch Lieferwege und Emissionen deutlich. Nach Ende des geförderten Pilotbetriebs übernimmt nun ein professioneller Parkraumbewirtschafter das Mikrohub, um den Betrieb dauerhaft und wirtschaftlich zu gestalten.
Solche Public-Private-Partnerships zeigen, wie Städte den Anstoß geben und private Akteur:innen die Konzepte verstetigen können.
Autofreie und verkehrsberuhigte Zonen: Wenn Innenstädte für Diesel-Fahrzeuge gesperrt oder zeitlich eingeschränkt werden, gewinnen Lastenräder einen Vorteil. Einige Städte richten Lieferzeitfenster ein, in denen nur emissionsfreie Fahrzeuge zulässig sind. In Berlin läuft z. B. ein Modellversuch, Teile der Friedrichstraße dauerhaft in eine Fußgänger- und Fahrradzone umzuwandeln – Lieferungen können dort künftig per Handkarren oder Cargo-Bike erfolgen.
Ähnlich entstehen in vielen Städten City-Zonen, wo Handwerker:innen und Lieferdienste spezielle Lastenrad-Parkzonen nutzen können. München will an U-Bahn-Stationen Paketboxen aufstellen, damit Kund:innen Sendungen flexibel abholen können und Zusteller:innen weniger durch die Viertel fahren müssen.
Solche Maßnahmen verbessern nicht nur den Verkehrsfluss, sondern steigern auch die Lebensqualität vor Ort: weniger Lärm, weniger Abgase und sicherere Straßen durch den Verzicht auf große Lieferwagen in engen Gassen.
Blick ins Ausland: Niederlande und Belgien als Vorreiter
Ein Vergleich mit den Niederlanden und Belgien zeigt, dass urbane Lastenrad-Logistik europaweit Fahrt aufnimmt.
Niederlande
Vor allem die Niederlande gelten als Vorreiter: Dort greifen ab 2025 in zahlreichen Städten umfangreiche Maßnahmen für eine Zero-Emission City Logistics. Zum 1. Januar 2025 haben bereits 14 niederländische Städte – darunter Amsterdam, Rotterdam, Utrecht und Den Haag – Zero-Emission-Zonen für den städtischen Lieferverkehr eingeführt.
Innerhalb dieser Zonen sind ab sofort schadstoffbelastende Lieferwagen und LKWs verboten; nur emissionsfreie Fahrzeuge (E-Transporter, E-Lastenräder etc.) dürfen noch in die Innenstädte liefern. Diese Regelung ist Teil eines langfristigen „Sticks-and-Carrots“-Ansatzes: Seit den 1970ern wurden in niederländischen Städten attraktive Alternativen zum Auto geschaffen (dichte Radwegenetze, gute ÖPNV-Anbindung) und gleichzeitig das Autofahren durch Verkehrsberuhigung und Einschränkungen unattraktiver gemacht.
Die neuen Zero-Emission-Zonen sind nun ein weiterer „Stick“ gegen städtische Emissionen, mit dem Ziel, bis 2030 nur noch 100 % emissionsfreie Fahrzeuge im Stadtverkehr zu haben. Übergangsfristen und Ausnahmeregeln geben Unternehmen Zeit zur Anpassung, doch der Trend ist klar: Diesel raus, E-Cargo-Bikes rein.
Bereits jetzt sind rund 9.500 Lastenräder in den Niederlanden im kommerziellen Einsatz – Tendenz steigend. Dadurch werden Lieferketten leiser und sauberer, was in dicht besiedelten Städten unmittelbar der Umwelt und den Bewohner:innen zugutekommt.
Belgien
Auch in Belgien setzt man auf innovative Fördermodelle. Ein Beispiel ist Gent: Die Stadt hat den Autoverkehr in der Innenstadt schon vor Jahren stark reduziert und möchte bis 2030 eine nahezu emissionsfreie City-Logistik erreichen.
Um lokale Unternehmen auf diesem Weg mitzunehmen, hat Gent 2024 zwei kreative Pilotprojekte gestartet:
- Händler:innen, Handwerker:innen und Non-Profit-Organisationen können kostenlos für eine Woche elektrische Lieferfahrzeuge testen – zur Auswahl stehen E-Lieferwagen, E-Kühltransporter bis hin zum E-Lastenrad, inklusive Beratung und maßgeschneiderten Logistik-Tipps.
- Betriebe erhalten 6.000 € Zuschuss, wenn sie einen lokalen Last-Mile-Lieferdienst beauftragen, der ihre Waren gebündelt vom Stadtrand aus per Cargobike in die City bringt.
„Die Stadtlogistik soll bis 2030 so emissionsfrei wie möglich sein, aber die Unternehmer:innen stehen dabei nicht allein. Wir geben ihnen Zeit zur Vorbereitung und bieten Unterstützung“, betont Gents Wirtschaftsdezernentin Sofie Bracke.
Ähnliche Förderungen gibt es etwa in Leuven oder Mechelen, wo Lastenrad-Lieferdienste ebenfalls mit kommunalen Mitteln angestoßen wurden. Belgien und die Niederlande demonstrieren somit, wie politischer Wille und konkrete Programme zusammenwirken, um E-Lastenräder zu einem festen Bestandteil der Stadtlogistik zu machen.
Strategische Chancen für Lieferdienste und Flottenbetreiber:innen
Die beschriebenen Entwicklungen eröffnen Lieferunternehmen, Kurierdiensten und Flottenbetreiber:innen vielfältige strategische Chancen. Wer früh auf E-Lastenräder setzt, kann nicht nur zum Klimaschutz beitragen, sondern auch handfeste wirtschaftliche Vorteile erzielen.
Flottenstrategie zukunftssicher ausrichten
Städte wie Hamburg und Amsterdam machen klar, dass künftig nur noch emissionsfreie Fahrzeuge ungehindert in Innenstädte gelangen. Eine Flotte mit E-Lastenrädern und E-Vans stellt sicher, dass Lieferdienste auch bei Zero-Emission-Zonen und Dieselverboten uneingeschränkt zustellen können.
Unternehmen wie Hermes reagieren bereits und wollen bis 2025 Dutzende Innenstädte komplett emissionsfrei beliefern – wer nachzieht, bleibt wettbewerbsfähig, wenn Städte die Daumenschrauben für Verbrenner anziehen.
Kostenvorteile nutzen
E-Lastenräder sind im Unterhalt günstiger als Vans (kein Kraftstoff, geringere Wartung) und können oft effizienter ausliefern, da Staus und Parkplatzsuche entfallen.
Eine Studie des EU-Innovationsprogramms EIT InnoEnergy zeigt sogar, dass bei großen Paketmengen eine Mischflotte aus 80 % E-Lastenrädern und 20 % E-Transportern gegenüber einer reinen E-Van-Flotte jährlich bis zu 554 Mio. € einsparen kann. Gleichzeitig würden die CO₂-Emissionen der letzten Meile um bis zu 80 % sinken.
Dies verdeutlicht: Die Investition in Cargobikes rechnet sich langfristig – ökologisch und ökonomisch.
Neue Geschäftsfelder erschließen
Durch die städtische Unterstützung entstehen rund um die Lastenrad-Logistik neue Märkte. Kurierdienste können etwa spezielle City-Logistik-Services anbieten – z. B. die Belieferung von Fußgängerzonen oder Umweltzonen per Lastenrad, als Sub-Dienstleister für große Paketdienste.
Auch Mikro-Depot-Betreiber:innen oder Sharing-Anbieter:innen für Cargo-Bikes (z. B. für lokale Händler:innen) sind Geschäftsfelder mit Potenzial. Unternehmen, die flexibel auf diese Nischen setzen, können sich als Innovationsführer:innen positionieren, während traditionelle Wettbewerber:innen noch Umstellungsbedarf haben.
Vorteile bei Ausschreibungen und Kundengewinnung
Immer häufiger schreiben Kommunen und Großkund:innen nachhaltige Logistiklösungen aus. Wer nachweislich CO₂-frei liefert, hat einen Bonus bei öffentlichen Ausschreibungen oder Verträgen mit umweltbewussten Auftraggeber:innen.
Städte berücksichtigen bei der Vergabe von Zustellkonzepten (z. B. für die Belieferung städtischer Einrichtungen oder Innenstadtkonzepte) zunehmend, ob Lastenräder eingebunden werden.
Eine grüne Logistikflotte wird so zum Verkaufsargument und Differenzierungsmerkmal. Zudem verbessert sich das Image beim Endkunden: Emissionsfreie Lieferungen per Lastenrad kommen bei einer umweltbewussten Stadtbevölkerung gut an und können die Kundenzufriedenheit steigern.
Fazit
Stadtlogistik im Wandel ist nicht länger Zukunftsvision, sondern gelebte Praxis in immer mehr Innenstädten. Deutsche Großstädte fördern E-Lastenräder durch Zuschüsse, Infrastruktur und Pilotprojekte – und reagieren damit auf Verkehrsprobleme, Klimaziele und Bürger:innenwünsche nach besserer Lebensqualität.
Ein Blick in die Niederlande und nach Belgien zeigt, dass mutige Maßnahmen wie Zero-Emission-Zonen und großzügige Förderprogramme den Wandel beschleunigen können.
Für Lieferunternehmen und Flottenbetreiber:innen zahlt es sich strategisch aus, den Trend frühzeitig aufzugreifen: Wer seine Flotte elektrifiziert, auf Cargo-Bikes setzt und sich auf urbane Mikro-Depot-Konzepte einlässt, wird zum Gewinner der neuen Stadtlogistik.
Emissionsfreie Lieferketten bedeuten weniger Stau und Abgase, aber auch neue Geschäftsmodelle und Kostenvorteile. Innenstädte, Unternehmen und Bewohner:innen profitieren gleichermaßen, wenn Lieferverkehr vom Lieferwagen aufs Lastenrad verlagert wird.
Die Förderung von E-Lastenrädern ist somit mehr als nur Umweltpolitik – sie ist ein zentraler Baustein für die zukunftsfähige, lebenswerte Stadt von morgen.